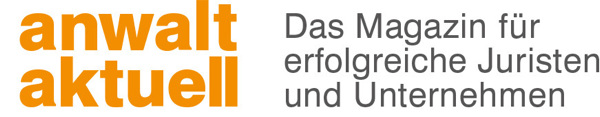Anwalt Aktuell: Herr Professor Ennser-Jedenastik, welchen Zeitraum haben Sie untersucht? Gibt es eine Art Startpunkt für die forcierte Besetzung von Sektionsleitungen durch Mitarbeiter:innen aus Ministerkabinetten?
Ennser-Jedenastik: Die Untersuchung beginnt 1970 und endet 2023. Es gibt in diesem Zeitraum keine Phase, in der es in eine oder eine andere Richtung kippt. Wir beobachten allerdings einen sukzessiven Anstieg ab den 1970-er-Jahren bis etwa 2010, wo bereits 40% der Ernennungen von Sektionsleitungen durch Personen aus Ministerbüros stattfinden. Auf diesen hohen Niveau hat es sich dann eingependelt. In den Siebzigerjahren waren es noch 10 Prozent. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Kabinette zu dieser Zeit noch ziemlich klein waren.
Anwalt Aktuell: In welchen Ministerien hat sich diese Art der Besetzung von Führungspositionen besonders etabliert?
Ennser-Jedenastik: Im Bundeskanzleramt wurde diese Praxis der Postenbesetzung am häufigsten angewandt. Sie machte hier ein Drittel der
Berufungen aus. Ähnlich hohe Zahlen sehen wir auch im Außenministerium. Hier muss man ergänzen, dass es im Außenministerium eine stärkere Tradition gibt, die Kabinette mit Leuten aus der
Verwaltung zu besetzen. Diese Personen rotieren nicht selten von der Verwaltung ins Kabinett und wieder zurück. Das wäre von der Postenbesetzung her gesehen ein weniger problematischer
Fall.
Anwalt Aktuell: Früher war Sektionschef ein Job fürs Leben. Sind die Verträge hier nicht mittlerweile befristet?
Ennser-Jedenastik: Mitte der Neunzigerjahre hat man das geändert. Seither sind Sektionsleitungen fürs erste einmal auf fünf Jahre befristet. Man hat das damals besonders unter dem Aspekt des Leistungsanreizes gemacht.
Anwalt Aktuell: Haben Sie überprüft, wie es in den jeweiligen Ministerien ankommt, wenn jemand aus dem Ministerkabinett plötzlich zum Sektionschef wird?
Ennser-Jedenastik: Nein, das wissen wir nur anekdotisch. Wenn man mit Leuten aus der Verwaltung spricht, hört man, dass es oft an der Motivation fehlt, sich für Spitzenposten zu bewerben, da man sich keine Chancen ausrechnet. Das ist als Leistungsanreiz sehr schlecht. Wenn es von Vorteil ist, politische Connections zu haben, dann demotiviert das natürlich Leute, die potentiell gleich gut oder besser sind, sich zu bewerben.
Anwalt Aktuell: Welche Partei hat von der dargestellten Besetzungspraxis am meisten profitiert?
Ennser-Jedenastik: Das ist je nach Untersuchungszeitraum verschieden. Von 1970 bis zur Jahrtausendwende ist es stärker die SPÖ, aus deren Kabinetten diese Besetzungen vorgenommen werden. In den jüngeren Jahrzehnten ist es viel stärker die ÖVP. Ab den Schüssel-Jahren holt sie dann quasi auf und ist mittlerweile die klar führende Partei in diesem Thema.
Anwalt Aktuell: Haben Sie einen internationalen Vergleich? Ist die von Ihnen erforschte österreichische Besetzungspraxis auch anderswo üblich?
Ennser-Jedenastik: Es gibt sehr wenig internationale Forschung, die sich dieser Frage widmet. Es mag dieses Phänomen auch in den Verwaltungstraditionen anderer Länder geben. Was wir erforscht haben, ist schon eine österreichische Besonderheit. Der Weg vom Ministerkabinett in eine Spitzenposition in der Verwaltung ist zumindest für andere Länder nicht so dokumentiert. Empirisch wissen wir es bisher nur von Österreich.

UNIV. PROF. MAG. MAG. DR. LAURENZ ENNSER-JEDENASTIK
ist Professor für Österreichische Politik
im Europäischen Kontext
am Institut für Staatswissenschaften
der Universität Wien